Feministische Sachbücher haben in Deutschland gerade Hochkonjunktur. Doch nicht jedes Buch ist eine Bereicherung in der Debatte nach mehr Gleichberechtigung. Wie „Sexuell verfügbar“ von Caroline Rosales zum Beispiel.
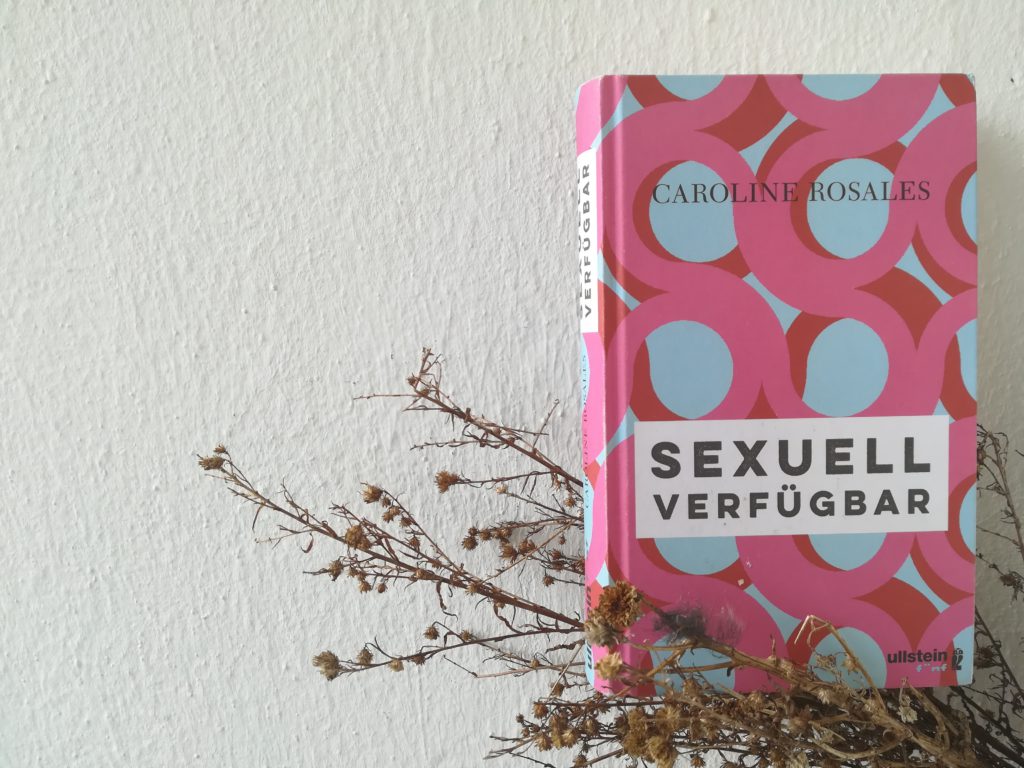
Nach ein paar Seiten wird schnell klar: da hat jemand mächtig Frust. Das muss per se nicht schlecht sein. Wenn er Missstände anprangert und im besten Fall Veränderungen in Gang setzt, kann er durchaus fruchtbar sein. Rosales Frust kreist aber hauptsächlich um sie selbst und um das Fehlverhalten der anderen, selten um ihr eigenes.
Die Hölle, das sind die anderen
Da ist zum einen ihr Vater, der die eigene „wunderschöne“ Mutter für eine jüngere Frau verlässt. Rosales lässt sich als Erwachsene später dann selbst auf einen älteren, verheirateten Mann ein. Mit sich selbst geht sie aber nicht so hart ins Gericht, wie mit ihrem Vater. Dann sind da die übergriffigen, männlichen Arbeitskollegen in den Zeitungsredaktionen. Fast doppelt so alt wie die Autorin. Was Rosales von ihnen will, wird nicht ganz klar. Das Spiel aus Macht und Sex geht sie dann trotzdem ein. Und dann gibt es natürlich noch die stutenbissigen Frauen. Freundinnen, die nur Neid und Missgunst verbreiten. An sich ein wichtiges und problematisches Thema. Denn Sexismus kann nicht nur von Männern ausgehen. Geht es aber um ihre eigene Missgunst, bleibt diese im Buch angedeutet und nicht zu Ende reflektiert.
…und die Moral von der Geschicht‘?
Doch worum geht es überhaupt in dem Buch? Tja, wenn die Autorin das selbst wüsste. Hauptsächlich geht es um Rosales Erlebnisse mit Sexismus. Mal subtil, mal offensichtlich. Es sind Erfahrungen als kleines Mädchen einer deutsch-französischen Familie des Bürgertums. Als Teenager in den 90-er Jahren und Schülerin einer religiösen Mädchenschule. Als junge Frau, die im Journalismus Erfolg haben will. Es geht um die Erziehung von Mädchen, die früh suggeriert bekommen, sie müssten Heiratsmaterial für Männer sein. Es geht um patriarchale Machtstrukturen, an denen – wenn überhaupt – attraktive, junge Frauen partizipieren dürfen.
Subjektive Erfahrungen sind wichtig für politische Diskussionen. Trotzdem bleibt die Autorin zu sehr in ihrer eigenen Gedankenwelt, um einen Mehrwert kreieren zu können. Manche beschriebenen Situationen kommen doppelt und dreifach vor und führen ins Leere. Die Kapitelüberschriften scheinen dem Inhalt eine Ordnung zu geben, sind aber überflüssig.
Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehn!
Nicht jede*r muss als zweite Simone de Beauvoir auf die Welt kommen, um glaubwürdig und kompetent über Feminisimus schreiben zu können. Die irische Autorin Emer O’Toole beschreibt in „Girls will be Girls“ (bitte unbedingt lesen!) ihre Wandlung zur Feministin. Als Teenagerin wollte sie vor allem fuckable sein und von Männern begehrt werden. Sie mied jeden Gedanken an eine feministische Emanzipation wie eine ansteckende Krankheit. Mit Halloween kam der Wendepunkt. Verkleidet als Junge findet sie Gefallen daran, mit Genderrollen zu spielen. Schnell beginnt sie, die gängigen Schönheitsanforderungen der Gesellschaft zu hinterfragen. Sie hört mit viel Überwindung auf, sich zu rasieren. In einem Fernsehinterview winkt sie stolz mit ihren unrasierten Achseln in die Kamera. Der negative Backlash der Zuschauer*innen danach ist immens. O’Toole bleibt weiter unrasiert. Trotzdem kratzen die angeekelten Blicke in der U-Bahn stark an ihrem Selbstbewusstsein.
Das, was O’Toole im Selbstexperiment ausreizt, bleibt bei Rosales nur ein angedeutetes Gedankenspiel. Immerhin erlaubt sie ihrem Sohn, am Ballettunterricht seiner Schwester teilzunehmen. Sie versichert ihren Kindern immer wieder, dass sie jeden Menschen heiraten dürfen. Sehr löblich! Zumindest ist der Grundstein für die nächste Generation gelegt.
Wirklich ärgerlich wird es aber, wenn Rosales über das Leben Alleinerziehender schreibt:
„Als noch unglückliche Verheiratete mit Anfang 30 hatte ich schon Jahre zuvor voller Bewunderung auf sie geblickt in der Hoffnung, dieses Gefühl mit Befremdung zu verwechseln. Sie scheinen ein so viel interessanteres Leben als ich zu haben. Sie gingen aus, ihre Geschwister und Freunde babysitteten oder sie nahmen ihre Kleinen einfach abends ins Restaurant mit.“
Es ist kein Verbrechen, privilegiert zu sein. Aber dann sollte man zumindest so viel Selbstreflexion besitzen und wissen, dass dieses romantische Bild einer alleinerziehenden Mutter massiv an der Realität der meisten Frauen in Deutschland vorbeischwappt. Wenn es nicht sogar ein Schlag ins Gesicht ist. Altersarmut, fehlende Unterhaltszahlungen der Väter, Kita-Wartelistenplätze und der Spagat zwischen Beruf und Kindererziehung lassen grüßen.
Außer Namedropping nichts gewesen
So lange man „Sexuell verfügbar“ als einen autobiografischen Bericht liest und keine aussagekräftigen empirischen Daten und Studien geschweige denn Selbstversuche erwartet, ist es okay. Mehr aber auch nicht. Hin und wieder erwähnt Rosales dann andere Feministinnen oder Studien zum Thema Gleichberechtigung, die durchaus lesenswert sind. Bei Rosales bleiben sie aber nur schmuckes Beiwerk.
Auf den letzten Seiten schreibt sie:
„Das Buch hat mir geholfen, meine ewigen Gedankenspiralen zu stoppen, Dinge zu benennen, meine Eifersuchten [sic!], meine Ängste, meine Sorglosigkeit und mein Glück.“
Ein Tagebuch hätte es auch getan.
Lest stattdessen lieber:
Emer O’Toole – Girls Will Be Girls: Dressing Up, Playing Parts and Daring to Act Differently
Bascha Mika – Die Feigheit der Frauen: Rollenfallen und Geiselmentalität
Margarete Stokowski – Untenrum frei und Die letzten Tage des Patriarchats

Schreibe einen Kommentar