„Der kleine Hobbit“, „On The Road“, „Anna Karenina“, „Schiffbruch mit Tiger“ – die Liste der aktuellen Literaturverfilmungen ist lang. Ebenso die Liste der Ansprüche, die man an eine gute Literaturverfilmung stellt. Man ist eben grundsätzlich skeptisch, ob Regisseure es schaffen, den literarischen Stoff stimmig und gebührend auf die große Leinwand zu bringen.
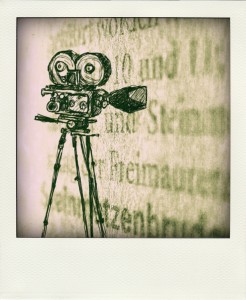 Allzu oft wird Regisseuren von Literaturverfilmungen vorgeworfen, sie seien dem Werk nicht treu geblieben und hätten zu viele Änderungen vorgenommen: Nebenhandlungen werden gestrichen, eine Romanze hinzugedichtet, das Ende ausgeschmückt. Doch es stellt sich die Frage, wie man Änderungen überhaupt umgehen kann, wenn die literarische Vorlage in ein völlig anderes Medium übertragen wird. Muss es damit nicht zwangsweise zu Differenzen kommen? Immerhin gilt es, eine Filmlänge von meist 90 bis 140 Minuten zu erreichen – in Lesestunden umgerechnet käme man in dieser Zeit wahrscheinlich nicht weiter als bis Seite Siebzig. Und würde man aus einem 1200-Seiten-Schmöker à la Anna Karenina ein Bibel-dickes Drehbuch schreiben, säße man demnach sicherlich eine Woche lang im Kino. Für eine qualitativ hochwertige Literaturverfilmung sind Änderungen also unumgänglich. Kürzungen somit auch. Hinzu kommen außerdem die persönlichen Vorstellungen und Intensionen der Drehbuchautoren sowie Regisseure, die unweigerlich in jede Verfilmung einfließen. Während viele Millionen Leser sich ihre ganz persönliche Welt entwerfen, wird auf der Leinwand nur eine einzige gezeigt. Der wahre Grund so mancher Enttäuschung ist also wohl eher der Zusammenbruch der eigenen Imagination, die man sich beim Lesen in liebevoller Kleinstarbeit aufgebaut hat. Durch die Verfilmung erhält der Roman nun konkrete Bilder und wird völlig neu erzählt. Die einzelnen Figuren bekommen eine reale Gestalt: Sherlocks Assistent Dr. Watson wird zum „kleinen Hobbit“ Bilbo Beutlin, und in Bernhard Schlinks „Der Vorleser“ wird die grobe, ganz gewöhnlichen Frau Hanna schon mal zur anmutigen Kate Winslet. Und das Fatale daran: Gerade bei Fehlbesetzungen spuken einem die Schauspieler auf ewig im Kopf herum, die Film-Hanna (warum denke ich bei ihr bloß ständig an „Titanic“?) ist von da an immer dominanter als die zart imaginierte Roman-Hanna. Die eigene Vorstellung kann in den seltensten Fällen gegen eine Verfilmung ankommen.
Allzu oft wird Regisseuren von Literaturverfilmungen vorgeworfen, sie seien dem Werk nicht treu geblieben und hätten zu viele Änderungen vorgenommen: Nebenhandlungen werden gestrichen, eine Romanze hinzugedichtet, das Ende ausgeschmückt. Doch es stellt sich die Frage, wie man Änderungen überhaupt umgehen kann, wenn die literarische Vorlage in ein völlig anderes Medium übertragen wird. Muss es damit nicht zwangsweise zu Differenzen kommen? Immerhin gilt es, eine Filmlänge von meist 90 bis 140 Minuten zu erreichen – in Lesestunden umgerechnet käme man in dieser Zeit wahrscheinlich nicht weiter als bis Seite Siebzig. Und würde man aus einem 1200-Seiten-Schmöker à la Anna Karenina ein Bibel-dickes Drehbuch schreiben, säße man demnach sicherlich eine Woche lang im Kino. Für eine qualitativ hochwertige Literaturverfilmung sind Änderungen also unumgänglich. Kürzungen somit auch. Hinzu kommen außerdem die persönlichen Vorstellungen und Intensionen der Drehbuchautoren sowie Regisseure, die unweigerlich in jede Verfilmung einfließen. Während viele Millionen Leser sich ihre ganz persönliche Welt entwerfen, wird auf der Leinwand nur eine einzige gezeigt. Der wahre Grund so mancher Enttäuschung ist also wohl eher der Zusammenbruch der eigenen Imagination, die man sich beim Lesen in liebevoller Kleinstarbeit aufgebaut hat. Durch die Verfilmung erhält der Roman nun konkrete Bilder und wird völlig neu erzählt. Die einzelnen Figuren bekommen eine reale Gestalt: Sherlocks Assistent Dr. Watson wird zum „kleinen Hobbit“ Bilbo Beutlin, und in Bernhard Schlinks „Der Vorleser“ wird die grobe, ganz gewöhnlichen Frau Hanna schon mal zur anmutigen Kate Winslet. Und das Fatale daran: Gerade bei Fehlbesetzungen spuken einem die Schauspieler auf ewig im Kopf herum, die Film-Hanna (warum denke ich bei ihr bloß ständig an „Titanic“?) ist von da an immer dominanter als die zart imaginierte Roman-Hanna. Die eigene Vorstellung kann in den seltensten Fällen gegen eine Verfilmung ankommen.
Zudem darf man nicht vergessen, dass ein Film auch stets ein wirtschaftliches Projekt darstellt, das Gewinn erzielen soll. Und um größtmöglichen Gewinn erzielen zu können, muss der Film auf ein größtmögliches Publikum zugeschnitten werden. Themen wie Liebe und Leidenschaft, Schmerz und Verrat konnten Otto-Normal-Verbraucher doch immer schon ins Kino locken, oder? Also was bleibt dem literaturaffinen Herz, wenn es mal wieder heißt: „Was sich als Buch gut verkaufte, wird auch auf der Leinwand ein Erfolg!“? Literaturverfilmungen Boykottieren? Ignorieren? Die Figuren lieber zwischen den Buchdeckeln lassen? Oder sollten wir vielleicht unsere Ansprüche an Literaturverfilmungen überdenken?
Es wäre wohl das Beste, sich zuerst einmal zu entspannen. Anschließend sollte man sich klar machen: Eine Verfilmung ist und bleibt eine Adaption der literarischen Vorlage und soll in erster Linie unterhalten. Wenn der Regisseur also eine Darstellung bzw. Intention verfolgt, die mit der eigenen kollidiert, darf man sich nicht gleich verbittert und enttäuscht hinter seiner Popcorntüte verstecken. Und wenn es das absolute Lieblingsbuch ist, sollte man sich vielleicht überlegen, ob man sich eine Verfilmung wirklich anschauen möchte oder sich eine mögliche Ernüchterung lieber erspart.
Oder was meint ihr?

Schreibe einen Kommentar