Daniel Schreiber hat mit „Allein“ ein Buch geschrieben, das genau zur richtigen Zeit kommt – dabei ist es kein Corona-Buch.
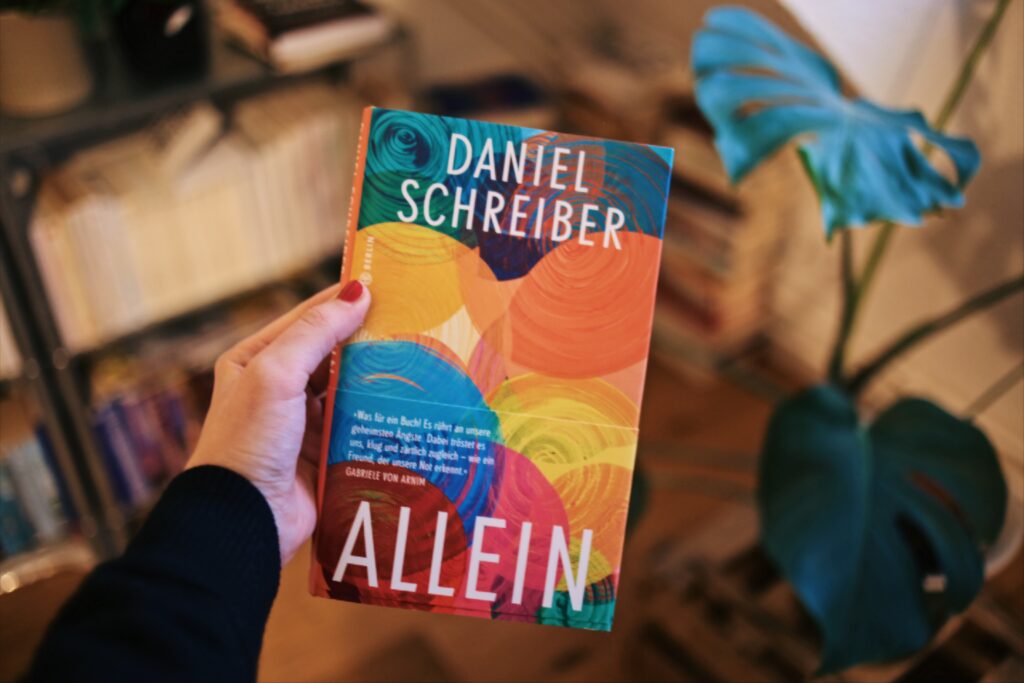
Ich wollte letztes Jahr wirklich kein Buch lesen, das etwas mit Corona zu tun hat. Auf meinem Bücherstapel im Lockdown-Winter landete vieles, aber bloß kein Buch über die Pandemie. Erst hatte ich deshalb gar keine Lust, Allein, den Essay, den Daniel Schreiber in ebendiesem letzten Lockdown-Winter geschrieben hat, zu lesen. Zum Glück habe ich es doch getan – und wenn ich 2021 nun Revue passieren lasse, dann fällt mir auf, dass Daniel Schreiber mit Allein genau das Buch geschrieben hat, das ich am liebsten schon im letzten Winter gelesen hätte.
Über 40 Prozent der Menschen in Deutschland leben allein. Warum ist es uns dann so unangenehm, über das Alleinsein, die Einsamkeit, zu sprechen? Warum wird ein Leben ohne feste Partner*innenschaft in unserer Gesellschaft noch immer als Scheitern betrachtet? Können wir denn wirklich nicht glücklich sein ohne eine romantische Beziehung? Das sind die Fragen, denen der Autor und Übersetzer Daniel Schreiber in Allein nachgeht. Schreiber, geboren 1977 in Mecklenburg-Vorpommern und mittlerweile wohnhaft in Berlin, reflektiert das Idealbild eines erfüllten Lebens, zu dem sein eigenes nicht zu passen scheint – und das, obwohl er in einer schönen Wohnung lebt, viele Freund*innen um sich herum hat, einer erfüllenden Arbeit nachgeht. Trotzdem fehlt etwas: ein fester Partner.
„Auch ohne eine Liebesbeziehung fühlt sich mein Leben oft erfüllt an. Und doch, trotz allem, bleibt eine Leerstelle, ein Rest Sehnsucht. Ich frage mich oft, ob ich nicht grundsätzlich etwas vermisse, ohne mir das einzugestehen. Ob ich so gut gelernt habe, allein zu leben, dass mir meine Einsamkeit nicht mehr auffällt.“
Daniel Schreiber in „Allein“
Einsamkeit: Das letzte große Tabu
Wie stigmatisiert Einsamkeit in unserer Gesellschaft ist, zeigt sich oft schon darin, wie schnell Menschen betonen, dass sie zwar allein seien, aber nicht einsam. Einsamkeit ist uns unangenehm, ein Geständnis, das keine*r machen will. Dass aber auch selbstgewähltes Alleinsein schnell in Einsamkeit umschlagen kann, mussten viele alleinlebende Menschen gerade in der Pandemie erfahren. Und so berichtet Daniel Schreiber in sehr persönlichen Passagen des Textes, in welche emotionalen Täler ihn die Isolation in den Lockdown-Monaten stürzte. Deshalb hat Allein dann doch etwas mit der Pandemie zu tun – obwohl das Wort mit C kein einziges Mal erwähnt wird.
Allein ist aber auch deshalb kein „Corona-Buch“, weil der Autor mit der Lektüre und Recherche zum Thema Alleinsein schon begonnen hatte, lange bevor in den Nachrichten von einem Virus die Rede war. Schreiber zieht allerlei Kompliz*innen heran, Schriftsteller*innen oder Wissenschaftler*innen, die ihrerseits über das Alleinsein nachgedacht und geschrieben haben. Allein ist voll von Querverweisen auf die klugen Gedanken anderer, von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Philosophie, Psychologie oder Soziologie. Deshalb wächst die eigene Lektüreliste beim Lesen von Allein auch ständig mit, und wer Schreibers Essays gelesen hat, den überrascht es nicht, dass der Nachruf auf die kürzlich verstorbene Joan Didion in der ZEIT ebenfalls von ihm verfasst wurde.
Apropos Didion: Überhaupt scheint die Kunst des langen Essays, wie Daniel Schreiber sie in seinen Büchern betreibt, in der deutschsprachigen Literaturlandschaft bislang noch nicht so etabliert und geschätzt zu sein wie unter seinen angloamerikanischen Kolleg*innen. Schreiber, der selbst viele Jahre in New York gelebt hat, ist in dieser Disziplin sichtbar zuhause: Mühelos verwebt er das Persönliche mit dem Gesellschaftspolitischen, zitiert Audre Lorde, Roland Barthes, Hannah Arendt oder Aristoteles, ohne, dass seine Verweise je der Ausschmückung, dem bloßen name dropping dienen würden. Er schreibt stilistisch so glasklar, dass man merkt, dass er sich ganz genau überlegt hat, was hier hingehört und was nicht. Das Faszinierende: Diese präzise Komposition des Textes tut seiner berührenden Intimität keinen Abbruch. Schreibers Essay liest sich so persönlich, als würde man seinen Gedanken wirklich beiwohnen dürfen; nur eben ohne das Chaos, die verwirrenden Schleifen und Windungen, die das Denken eigentlich nimmt. Das hier ist das Gegenteil von stream of consciousness, es ist ein vorsichtig zusammengesetztes Gebäude von Sätzen, wieder und wieder und wieder redigiert, bis wirklich alles sitzt. Das macht die knapp 140 Seiten von Allein zu einem so dichten Leseerlebnis – und zu einem Text, der sich immer wieder neu lesen und entdecken lässt.
Von der Kunst, sich selbst zu reparieren
Auch wenn Schreibers Beschäftigung mit dem Thema schon viel früher begann, kam die pandemiebedingte Aktualität der Veröffentlichung des Buches natürlich zugute. Seit Monaten ist das schmale Buch mit dem auffällig-bunten Katharina-Grosse-Cover überall zu sehen: auf Bookstagram, auf den Verkaufstischen. Der Erfolg ist so groß, dass er Schreibers Vorgängerwerke gleich mitzieht: Auch Zuhause und Nüchtern, erschienen 2014 und 2017, wurden in diesem Herbst wieder von vielen Menschen gelesen. In Zuhause beschreibt Schreiber unter anderem die seelischen Misshandlungen, die er in seiner Kindheit in der DDR erlebt hat; an den Satz “Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu misshandeln” muss ich immer wieder denken. Wer Zuhause schon kennt, wird auch daran denken, wenn Daniel Schreiber in Allein von queerer Scham schreibt.
In Allein berichtet Daniel Schreiber auch davon, welche Wege er fand, während der Pandemie mit der Einsamkeit umzugehen, und sie klingen erst mal erstaunlich trivial: wandern, joggen, stricken, Yoga, gärtnern. Klassische Lockdown-Hobbys eigentlich. Was dahintersteckt, ist natürlich ein wenig komplexer: Daniel Schreiber will deutlich machen, dass Selbstfürsorge, gerade in Krisenzeiten, mehr ist als die vielbeschworene, von neoliberalen Glaubenssätzen geprägte „Self Care“. Es geht darum, Dinge zu finden, bei denen wir Selbstwirksamkeit erfahren, uns Raum verschaffen. Er gibt diesen Praktiken sogar einen neuen Namen, einen, der weniger nach Gesichtsmasken und Meditations-Apps klingt, sondern in seiner Schonungslosigkeit den psychischen Notlagen in einer Pandemie schon eher angemessen ist: Er nennt sie „Selbstreparatur“.
Selbstfürsorge, gerade in Krisenzeiten, ist viel mehr als die vielbeschworene, von neoliberalen Glaubenssätzen geprägte „Self Care“.
Am Ende von „Allein“ lässt sich Daniel Schreiber nicht dazu hinreißen, die Frage, ob man auch ohne Partner*innenschaft glücklich sein kann, wirklich zu beantworten, jedenfalls nicht für die Allgemeinheit. Dennoch kommt er zu der Erkenntnis, dass es manchmal notwendig ist, sich von bestimmten Vorstellungen und Lebensentwürfen zu verabschieden, und zwar genau dann, „wenn wir merken, dass sie unsere Sicht auf die Dinge verzerren und zu selbstgebauten Gefängnissen werden.“
Allein ist vor allem ein Versuch: Wir müssen als Gesellschaft damit anfangen, über Einsamkeit nachzudenken, sie wahrzunehmen und über sie zu sprechen. Wie Nüchtern und Zuhause wirkt Allein aber auch deshalb nach, weil es so deutlich macht, welche Kraft hinter der literarischen Selbsterfahrung steckt. Und weil es immer wieder daran erinnert: In Gesellschaft großartiger Autor*innen ist man weniger allein. Wenn in meinem Leben das nächste Mal Lockdown ist, werde ich Allein also sicherlich noch mal aus dem Regal ziehen.
Daniel Schreiber: Allein. Erschienen bei Hanser, 2021.
- Queerer Schmerz war noch nie so lustig - 26. Oktober 2022
- Linus Giese: „Ich musste lernen, mich abzugrenzen“ - 4. Mai 2022
- Tauchen im Bongwasser - 1. Mai 2022