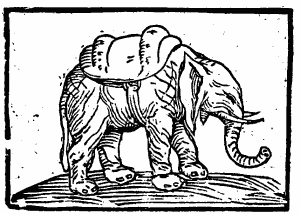
Berlin ist eine Stadt, in der jene Begegnungen zur festen Gewohnheit gehören, die manche Auswärtigen nach ihrem Besuch in heimischer Runde als ungewöhnlich bezeichnen. Denn in dieser Stadt versteckt sich der Zufall hinter jeder Straßenecke und wartet neckisch hinter den bemalten Rahmen verdreckter Hauseingänge, um einen dann willkürlich zu überfallen. In Form aber eines großen, perlweißen Elefanten mit breiten, zerlumpten Ohrlappen, den langen, faltigen Rüssel zum Gruß über seinen einzigen Stoßzahn erhoben, tritt einem der Zufall, so sollte man meinen, selbst in einer Stadt wie Berlin nicht gegenüber. Und trotzdem ist es nun schon eine Woche her, dass ich eben dieses Tier dort, in den matten Lichtkegeln der in Reih und Glied aufgestellten Straßenlaternen wo sich Richardplatz und Hertzbergerstraße Gute Nacht sagten, angetroffen habe.
Am Morgen danach war mir hundeelend. Das erste, was mir nach dem Augenaufschlag durch den Kopf ging, waren Zweifel. Allgemeine Zweifel: Zweifel am Trinken, am Rauchen, an meinen sozialen Beziehungen, der Nacht und summa summarum dem ganzen vermaledeiten Leben. Nur die Kopfschmerzen pochten mir heftig und allzu real im Schädel herum – und dieses eine Bild. Dieses riesige weiße Geschöpf aus der letzten Nacht, das mir, über alle Zweifel erhaben, gegenüber gestanden hatte . Auch nach einer Tablette und dem ersten Kaffee war ich mir dessen nicht unsicherer geworden. Ich meinte sogar, mich an den gesamten Hergang des vorangegangenen Tages erinnern zu können. Jetzt, nach einer Woche, kann ich nicht mehr mit voller Gewissheit sagen, ob sich die Dinge wirklich so zugetragen haben.
An diesem herbstlichen Tag, der die Reserven der Spätsommersonne über die Stadt verteilte, fiel mein Frühstück in den Mittag und die Wahl auf ein Café am Landwehrkanal, dessen Mobiliar aussah, als sei es zu nichts mehr zu gebrauchen, dessen auf einer Kreidetafel angepriesene Omeletts aber umso besser schmeckten. Ich bestellte, aß und zahlte – was normalerweise nicht meine Art war. Dass ich es dennoch tat, rächte sich. Denn statt das Wechselgeld in der Börse und diese ordentlich in meiner Jacken zu verstauen, stopfte ich es hastig in die Hosentasche, eilte hinaus auf die Backsteinpflaster und überließ meinem Geldbeutel seinem eigenen Schicksal. Den Verlust bemerkte ich erst mehrere Straßen und Stunden später. Zuvor hatte ich allerdings noch zwei außerordentliche Termine in meinem Kalender stehen, die meiner Anwesenheit so dringend bedurften, dass sich keiner meiner Gedanken auch nur annähernd um die Geldbörse scherte. Meistens rufen sich solche Dinge nur durch ihren Gebrauch zurück in die Sinne, in meinem Fall aber hatte diese Funktion die zerfledderte Tasche meiner Jeans übernommen.
Zuerst traf ich mich mit einem guten Freund, dessen empfindliches Gemüt in letzter Zeit ein paar Hiebe zu viel eingesteckt hatte. Geduldig hörte ich mir seine Geschichten an, sprach ihm gut zu, wobei er sich in seinem Leid von keinem Menschen unterschied, den man sonst in Berlin antreffen kann. Banal will ich es nicht nennen, wenn es denn wirklich stimmte, was er so selbstmitleidig vortrug, denn es gereichte mir immerhin soweit zum Vorteil, dass er jede der fünf bestellten Runden aus seiner Hand bezahlte. Inzwischen bin ich mir nicht mehr sicher, ob es seine Flut an traurigen Lebensepisoden oder der seltsame Schnaps war, der mir wenig später bitter im Magen herum trieb. Zumindest war mir nach der Konversation nicht mehr ganz so wohl, obwohl die wichtigste Verabredung noch bevorstand. Ich verließ die Bar auf den Mehringdamm. Den Weg zu der vereinbarten Kneipe namens Bäreneck, wo sich Flughafen- und Boddinstraße kreuzen, schlenderte ich merkwürdig berauscht unter der warmen, frühen Abendsonne durch die Hasenheide.
Vor dem Bäreneck wartete sie schon mit den Händen in ihren weiten, schwarzen Manteltaschen. Als sie mich erkannte, trat sie zwei, drei Schritte auf mich zu und streckte ihre schrumpelige linke Hand zur Begrüßung hervor. Ich reichte ihr meine und wir gingen hinein. Meine Erinnerungen sind sich nicht mehr einig, ob es zwischen dem folgenden Gespräch die gleichen abnormalen Schnäpse wie beim Treffen zuvor oder ein noch viel schlimmeres Gebräu gegeben hatte. Jedenfalls diente es zunehmend meinem inneren Karussell als Hochleistungstreibstoff. Wir sprachen darüber, was in meinem Leben passierte, wechselten dann aber schnell zu dem ihren. Gegen Ende schob sie mir noch einen Batzen Scheine unter dem Thekentisch zu. Das war der Punkt, an dem ich merkte, dass sich meine Börse verselbstständigt hatte, was eine unabwendbare Unruhe in mir heraufbeschwor. Ich fand mein Wechselgeld, das ich mit dem frischen Haufen vermischte. Nach einem kurzen Entschuldigungskanon an meine Stifterin brach ich den letzten Schluck hinunter und ließ sie mit enttäuschtem Kopfschütteln im Bäreneck zurück.
Wie viel Zeit ich wirklich darin verbracht hatte, ist mir bis jetzt schleierhaft. Ich weiß nur, dass sie draußen in großen, merklichen Bögen voran gesprungen sein musste. Alles um die drehenden Lichter um mich herum lag kühl und dunkel unter einer bewölkten Nacht verschüttet. Langsam und kurvig zog ich einen irrsinnigen Umweg durch die Flughafen- und über die Karl-Marx-Straße zum Hermannplatz hinab. Was dann geschah, kann nicht einmal der Herr Gott erklären, denn dort angekommen, ritt mich auf einmal der Teufel. Wie vom Dreizack gestochen, stiefelte ich in die nächstbeste Kneipe und orderte den verdorbensten Schnaps, den die Karte zu bieten hatte, indem ich meinen Finger wie einen Dartpfeil blind auf sie warf. Ich trank gleich zwei Kurze in Reihe. Wie viele ihnen nach folgten, kann ich nicht mehr aufzählen und konnte es wahrscheinlich auch in dem Moment nicht mehr, an dem ich wieder unsanft auf der Straße landete. Ich kroch mit der verschwommenen Idee, mich zu nächtlicher Stunde vollkommen dicht um meinen Geldbeutel kümmern zu wollen, den ganzen Weg zurück zum Anfang des Tages. Nur dass ich eben genau dort nicht landete.
Unkontrolliert wie ich war, besorgte ich mir in einem der unzähligen Spätis, von denen es in Berlin mehr zu geben scheint als Gehirnzellen in meinem Kopf, abermals Alkohol. Im Nachhinein grenzt es an ein Wunder, dass ich mein Verlangen in welcher Form auch immer verständlich nach außen brachte, denn auf dem weiteren, nicht mehr rekonstruierbaren Weg wankte ich in großzügigen Sinuskurven ins Ungewisse, der Hoffnung auf meinem Geldbeutel entgegen. Kein Mensch kann mir erzählen, dass er nach dem Ritt in einer Zentrifuge nicht für zumindest eine kurze Dauer ohne Orientierung ist. Meiner dauerte zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Stunden und hatte mich gänzlich aus dem mir bekannten Raum-Zeit-Gefüge katapultiert. Daher habe ich auch keinerlei Erinnerung mehr daran, was mit mir, der Flasche oder sonst auf der Welt um mich herum passierte, bis, ja bis der Widerstand gegen die Schwerkraft mich aus den Angeln hob und auf die harte Straße warf.
Der Asphalt küsste mir die Lippen blutig. Die Schmerzen blieben wie mein Verstand vom Rausch verschluckt und ich für einige Zeit am Boden. Es dauerte eine Weile, bis ich überhaupt begriff, dass ich nicht nur meinen Geldbeutel, sondern auch den Vollbesitz meiner Wahrnehmung für das, was gerade passiert war, verloren hatte. Als ich meine horizontale Lage jedoch erkannte, versuchte ich mich aufzustützen. Da durchfuhr es mich kalt, wie ein Schuss Adrenalin, denn keine zehn Meter vor mir saß das schneeweiße Geschöpf von trauriger Gestalt. Ich richtete mich mit Mühe in eine halbwegs komfortable Sitzposition und betrachtete das Tier mit ernüchterndem Herzschlagen. Was weiß ich jetzt noch, wie lange wir uns so gegenseitig anstarrten? Was ich aber weiß ist, dass es ein tiefer, hypnotischer Blick in seine kleinen, von faltigen Brauen zusammengezogenen Knopfaugen war. Mir kam es vor, als wollte mir das Tier, in welcher Sphäre auch immer, eine Botschaft zukommen lassen.
Ich verstand nichts.
Plötzlich erhob es sich auf alle Viere und hinter ihm kam ein kopfgroßes, elfenbeinfarbenes Ei zum Vorschein. Behutsam griff der Elefant danach, hob es auf und legte es in das Nest seines breiten Nackens. Dann trat er auf mich zu, umschlang mich mit dem Rüssel und bettete mich auf seinen Rücken. Das ist das Letzte, was ich von dieser Nacht noch zu erzählen weiß. Danach kam nichts mehr, bis zum folgenden Morgen mit all den Kopfschmerzen und Zweifeln. Und meinem Geldbeutel. Diese Tatsache kollidierte so sehr mit meinen Erinnerungen der vergangenen Nacht, dass ich dachte, ich wäre verrückt. Ich rekonstruierte das Geschehene wieder und wieder und immer hatte es denselben Ablauf, dieselben Lokale, Personen und Schnäpse. Das ich aber nun, sieben Tage danach noch immer zweifele, was wirklich und was nicht ist, liegt weder an dem frohen Wiedersehen mit meiner Börse noch den hanebüchen erlebten Momenten. Es ist das marmorne Ei, das, als ich aufwachte, neben mir am Kopfende meines Bettes lag und seitdem dort liegt. Seit heute Morgen kann ich es nicht mehr ignorieren, denn die Schale bekommt kleine Risse. Meine Zweifel werden langsam zu Verzweiflung. Etwas beginnt, aus dem Marmor zu schlüpfen.
- Eine zweifelhafte Geschichte - 15. Oktober 2014
- Crumbs – Krümel, die die Welt bedeuten - 1. August 2014
- 51. Berliner Theatertreffen vom 5. – 18. Mai 14 - 29. April 2014