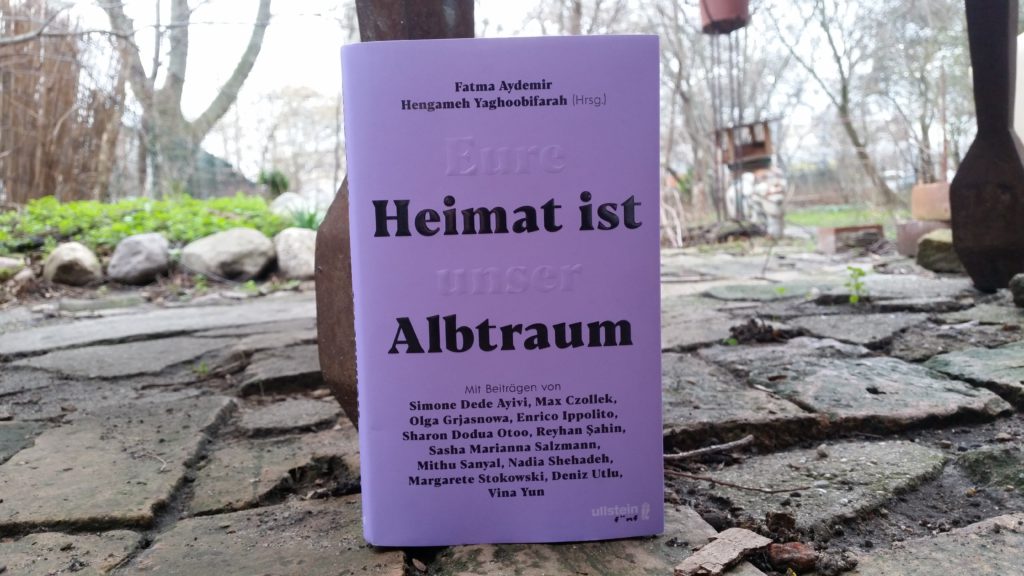Das Wort „Heimat“ hat es in den Titel eines deutschen Ministeriums geschafft: Vor einem Jahr ist das Innenministerium zum sogenannten Heimatministerium geworden. Dieses Jubiläum nehmen die Herausgeber_innen von Eure Heimat ist unser Alptraum, Fatma Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah, zum Anlass, um vierzehn Autor_innen mit Rassismuserfahrungen zu Wort kommen zu lassen.

Es ist der Freitag der Buchpremiere, die Schlange vor der Tür lang. Auf der Bühne stehen viele Sofas, die andeuten, dass die Herausgeber_innen ihr Buch heute nicht allein vorstellen werden. Kurz darauf füllen sich die Sofas mit den Menschen, die für die neue Anthologie Beiträge mit Namen wie Sichtbar, Arbeit und Liebe geschrieben haben. Auf den ersten Blick keine Titel, die in direkter Verbindung mit dem Wort „Heimat“ stehen. Am ehesten vielleicht noch Zuhause, Sprache oder Essen.
Die Herausgeber_innen übernehmen die Begrüßung und dann geht es los. Es ist eine Veranstaltung mit Tempo, schließlich sollen die zehn anwesenden Autor_innen alle zu Wort kommen. Und das tun sie. Und wie.
Die Texte sind so unterschiedlich wie die Stimmung, die durch die jeweilige Performance ausgelöst wird. Die Themen sind ernst, das ist klar, aber manche Texte sind so witzig geschrieben, so lebhaft vorgetragen, dass es schwer ist, das Lachen zurückzuhalten. Als weiße cis-Person frage ich mich manchmal, ob ich das darf, oder ob das eher eine Empowerment-Veranstaltung für nicht weiße Menschen ist, der ich zurückhaltend beiwohnen sollte. Das Lachen bricht dann aber trotzdem kurz heraus, und bleibt sofort wieder im Hals stecken, zum Beispiel bei Nadia Shehadeh. In ihrem Text Gefährlich beschreibt sie, wie sie mit einem Namen durchs Leben geht, der oft als Gefahr wahrgenommen wird:
[Ich hatte] das Glück, fast genauso zu heißen wie die libanesische Terroristin Nadia Shehadah Yousuf Duaibes. Shehadah war 1977 an der Entführung des Flugzeugs ,Landshut‘ beteiligt, und zu ihren Ehren war eine Zeit lang Anfang der Neunziger eine ,Antiimperialistische Wiederstandszelle‘ in Deutschland aktiv. Das lernte ich nicht selber oder freiwillig, sondern engagierte Lehrer_innen brachten es mir im Schulunterricht vor allen Mitschüler_innen bei.
Nadia Shehadeh lernt unfreiwillig eine Menge über Terror, den Irak oder 09/11, weil sie durch ihren arabischen Namen schon als Teenagerin in die Rolle der Expertin für diese Gespräche gedrängt wird. Ihr Geld verdient sie in der Zeit einerseits mit Lokaljournalismus und berichtet über Schweinenasen-Essen und Schützenfeste. Außerdem arbeitet sie im Callcenter, wo ihr Name nicht selten Grund für Anfeindungen und dumme Witze wird. Sie hat damit gelernt umzugehen, dank des jahrelangen Abstumpfungstrainings, wie sie ironisch anmerkt.
Nadia Shehadehs Text fordert weiße Leser_innen auf, über sich selbst und die kleinen Mechanismen im Alltag nachzudenken. Ein Text, bei dem man als weiße Person aufgefordert wird, über sich selbst nachzudenken, zum Beispiel wenn Nadia Shehadeh schreibt:
Sogar an die Unsichtbarmachung von arabischen Essen in der deutschen Vegan-Szene habe ich mich gewöhnt, aber Hummus ist ja auch kein Gefährder, und deswegen verdient er das Label ,arabisch‘ wahrscheinlich nicht.
Hier fühle ich mich ertappt. Auch ich esse gerne Hummus als Teil meines veganen Essens.
Ruhigeres Tempo
Deutlich ruhigere Texte und Vorträge kommen von Olga Grjasnowa, die über Privilegien nachdenkt, von Vina Yun, die eine Verbindung von Heimat und Essen herstellt oder von Sharon Dodua Otoo, die für ihren Essay Liebe ein Gespräch mit ihrem Sohn als Ausgangspunkt wählt.
Viele der Texte zeigen, wie ähnlich Erfahrungen verschiedener marginalisierter Gruppen sind, wie gleich die Mechanismen von Diskriminierung. Auf das Thema Mehrfachdiskriminierung geht zum Beispiel Sasha Marianna Salzmann ein, die in ihrem Essay Sichtbar ein Wir-Pronomen von auf den ersten Blick unterschiedlich diskriminierten Gruppen herausbildet. Nachdem sie und ihre Freundin in der Öffentlichkeit angegangen wurden, kommen zwei Männer hinzu:
Geholfen haben mir zwei Passanten, die phänotypisch unter das Raster ,Moslem‘ fallen. Ich kenne sie nicht weiter, wir haben uns, nachdem sie die Pöbler weggejagt haben, kaum unterhalten. Aber ich wusste, dass die beiden, als sie mir und meiner Freundin eine Zigarette anboten, das Gefühl der Verletzbarkeit, das wir in dem Moment empfanden, kannten. Diese beiden Männer von der Kottbusser Brücke […] sind Teil einer großen, sind Teil meiner Community. […] Wir sind die anderen, die wissen, dass normal uns nichts zu sagen hat. Normal ist keine Autorität für uns. Wir werden füreinander da sein, wenn die Mehrheitsgesellschaft zuschaut und nicht eingreift.
Noch mehr Paradoxa
Von unlogischen Zuschreibungen in der Gesellschaft berichtet auch Margarete Stokowski in Sprachen. Kinder, die bilingual aufwachsen, werden bewundert und sind später auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Eltern geben viel Geld für Schulen aus, damit die Kinder Englisch, Spanisch und Französisch lernen. Ihre Muttersprache, Polnisch, nahm Margarete Stokowski hingegen immer als Makel wahr, den sie verschwieg. Eine Sprache, die, wie sie lange glaubte, mit Bilingualität nichts zu tun habe.
Auch Fatma Aydemir beschreibt in Arbeit ein Paradoxon:
Ich bin im Deutschland der Neunzigerjahre aufgewachsen, in dem die widersprüchlichen Parolen ,Ausländer sind faul‘ und ,Ausländer nehmen uns die Arbeit weg‘ teilweise aus den selben Mündern miteinander konkurierten. […] Ich will den Deutschen die Arbeit wegnehmen. Aber nicht die Jobs, die für mich vorgesehen sind, sondern die, die sie für sich reservieren wollen.
Mithu Sanyal wählt einen anderen Zugang. Auch sie schreibt in Zuhause über eigene Erfahrungen. Das Konstrukt Heimat knöpft sie sich nochmal aus einer neuen Richtung vor: so denkt sie über „Haut, Haare, Hämoglobin“ nach und erklärt die Unterschiede zwischen Blutrecht, Bodenrecht und den daraus resultierenden Definitionen des Heimatbegriffes. Ihr Essay ist genau, teilweise in einem fast wissenschaftlichen Duktus verfasst und wurde von Mithu Sanyal mit großer Hingabe vorgelesen.
Die Anthologie Eure Heimat ist unser Alptraum reiht sich in eine Gruppe vieler wichtiger Textsammlungen ein, die in letzter Zeit erschienen: Sie sagte. 17 Erzählungen über Sex und Macht (Hanser Berlin), Das Herz verlässt keinen Ort, an dem es hängt (Ullstein) oder Freie Stücke. Geschichten über Selbstbestimmung (Nautilus) sind Beispiele dafür. Das Format der Anthologie erfährt darin einen Aufschwung, ihre Stärke liegt darin, vielen unterschiedliche Stimmen Raum zu geben. Das ist auch die Stärke von Eure Heimat ist unser Alptraum. Die Essays sind zudem niedrigschwellig genug, um die Botschaft als Lai_in zu verstehen. An dem Punkt lässt sich sicherlich auch Kritik üben, doch ich bin nicht die Person, die das tun sollte. Alle der hier aufgezählten Anthologien haben übrigens auch viele Autor_innenüberschneidungen, was zeigt, dass verschiedene Formen der Diskriminierung und Erfahrung mehr und mehr unter dem Begriff der Intersektionalität zusammengedacht werden. Die Anthologien handeln von verschiedenen Themen. Den gleichen Nerv treffen sie trotzdem.
Nachdem bei der Premiere die Worte des letzten Essays verklungen sind, legen die Herausgeber_innen Musik auf, die Gäste können mittanzen. Die Texte aus Eure Heimat ist unser Alptraum lassen sich als Empowerment für von Rassismus betroffene Menschen verstehen, das legt zumindest die Widmung „Für uns“ nahe, die auf einer der ersten Seiten zu finden ist. Für weiße Personen sind die Texte Fingerzeige auf Situationen, in denen Rassismus und Diskriminierung stattfinden. Situation, die man sich als weiße Person zwingend vor Augen führen muss, da man sie selbst auslöst. Diese Essays können dabei helfen. In ihnen geht es um Haut und Haare, es geht um Namen und Sprachen. Alles Faktoren, die zu den Erfahrungen führen, von denen die Autor_innen berichten. Beim Vortragen und beim Lesen der Texte wurde ich oft auf Dinge aufmerksam gemacht, die mir zuvor weniger präsent waren. Das Gefühl des Ertapptseins ist allgegenwärtig.
Der Essayband dekonstruiert das Wort „Heimat“ und zeigt, wie wenig zeitgemäß es ist. Ein Wort, das Menschen per Definition ausschließt und an einem Weltbild festhält, das im 21. Jahrhundert eigentlich überholt sein sollte. Umso verwunderlicher, dass man 2018 das historisch schwer belegte Wort „Heimat“ wieder so sehr rehabilitierte, dass es sogar den Namen eines Ministeriums zieren darf.
Fatma Aydemir / Hengameh Yaghoobifarah: Eure Heimat ist unser Alptraum, Ullstein fünf 2019.

- Die Gespenster von Demmin - 22. November 2020
- Streulicht - 4. November 2020
- Bezimena – Für die Namenlosen - 9. August 2020